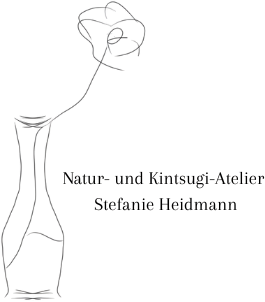In vielen Artikeln und LinkedIn-Beiträgen wird Kintsugi als Beispiel genutzt, um über menschliche Versehrtheit zu reden. Die Goldnähte werden dann gerne mit Narben verglichen. Mir ist bei dieser Lesart immer etwas unbehaglich zumute.
Zum Einen teile ich diese Sicht auf den Menschen nicht. Das eigentlich Erstaunliche finde ich nicht unsere Fähigkeit zum Leiden, sondern gerade unsere Fähigkeit zur Ganzheit. Wir können etwas, das uns widerfahren ist, in unsere Logik und Geschichte integrieren. Das erzeugt keine Narben. Vielmehr stricken wir beständig an einem neuen Ganzen.
Zum Anderen wird dieser Ansatz auch Kintsugi nicht gerecht. Im Kintsugi geht es für mich vor allem um unsere Beziehung zu den Dingen. Menschen fertigen einen Gegenstand. Dieser Gegenstand wird anderen Menschen wertvoll durch seine je eigene Beschaffenheit und seinen Gebrauch, auch durch den Wert, den er womöglich schon für jemand anderen hatte. Das Kaputtgehen ist ebenso Teil der gemeinsamen Geschichte wie das Reparieren. Auch im Kintsugi steht am Ende eine neue Ganzheit mit integrierter Geschichte. Die vorherige Kaputtheit ist dem Gegenstand in der Regel nicht mehr anzusehen. Er ist ein Anderer geworden.
Der Leuchter auf den Bildern ist streng genommen gar keine Kintsugi-Arbeit, weil Kintsugi wörtlich übersetzt „Goldverbindung“ heißt. Ein Finish mit poliertem Lack, wie hier auf dem Bild mit Schwarzlack, nennt man „Urushi Tsugi“. Der Petri-Leuchter von KPM – Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin wurde von Trude Petri entworfen und erstmals 1934 aufgelegt. Viele, die ihn zum ersten Mal mit den schwarzen Lacklinien sahen, waren ganz verblüfft, als sie hörten, er sei ein repariertes Objekt. Sie hatten das schwarze Muster für sein ursprüngliches Design gehalten.
Bei Interesse biete ich den Porzellanleuchter zum Verkauf an.